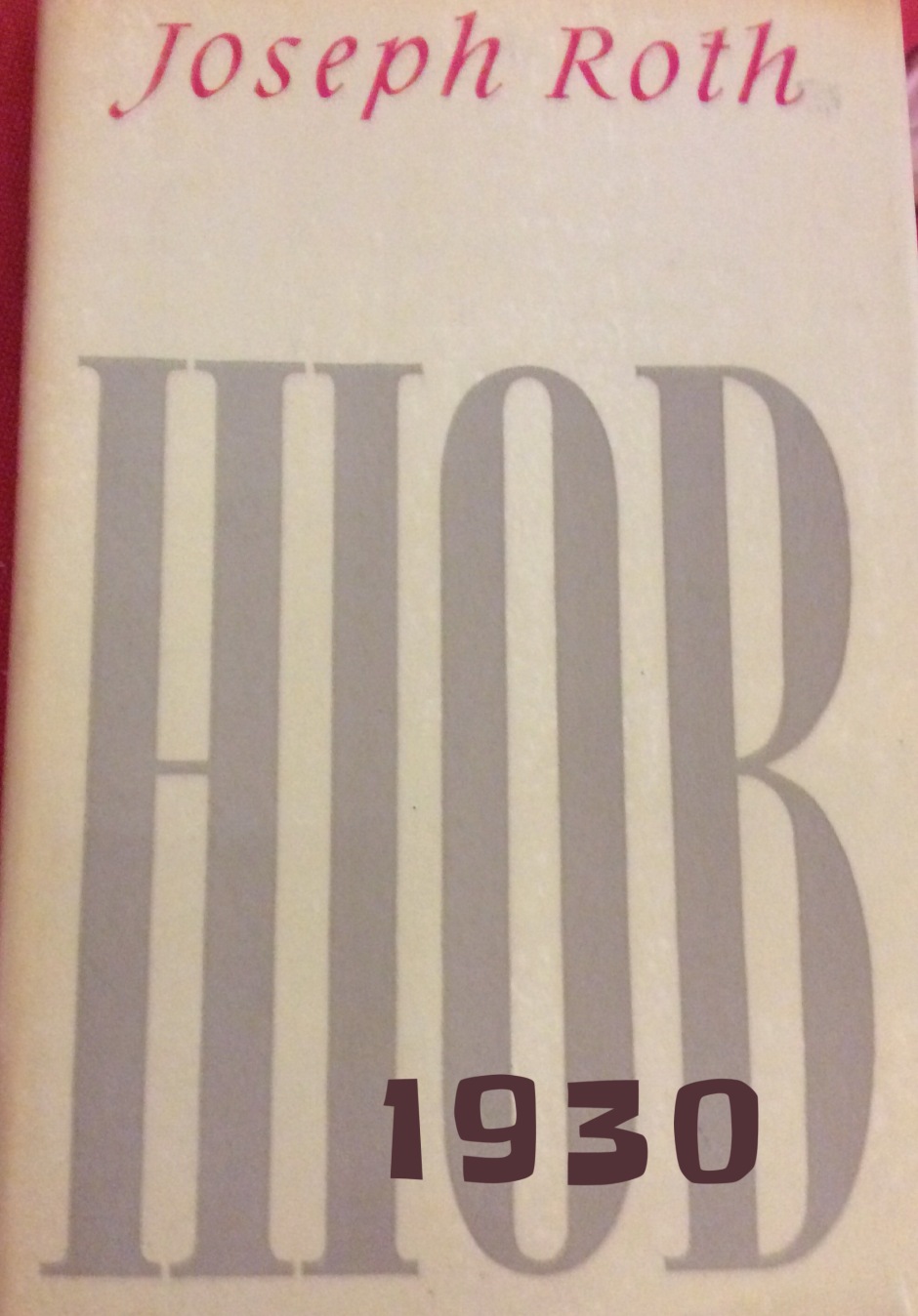Seit vielen Jahren bezirzt mich dieser Titel. „Zärtlich ist die Nacht“ – das klingt nach großem Gefühl und nach lauem Sommerabend. Schön. Dass F. Scott Fitzgerald gute Ideen hatte, habe ich schon vor Jahren bei… Mehr
1931: Wofür genau wird eigentlich der Literaturnobelpreis verliehen? – „Die gute Erde“ von Pearl S. Buck
Seit ich einen Freund habe, der vor langer Zeit einmal Sinologie studiert hat, fliegen mir Bücher über China vor die Füße. In dem Zusammenhang landete auch Pearl S. Buck in meinem Bücherregal. „Die gute Erde“ liest sich superschnell durch und gibt einen spannenden Eindruck in die Lebenswelt chinesischer Bauern vor 90 Jahren.
Im Zentrum des Romans steht Wang Lung, ein einfacher Reisbauer, der sehr arbeitssam ist und so am Ende einigen Wohlstand erreichen kann. Die Moral von der Geschicht ist vielleicht etwas platt. Ich sehe aber die Stärke des Buches nicht in seiner literarischen Hochwertigkeit. Was mich gepackt hat, waren die Schilderungen der Lebensumstände im ländlichen China. Alles fängt damit an, dass Wang Lung sich eine Sklavin als Frau holt als wäre es das normalste der Welt. Er tut das, weil es für ihn viele Vorteile hat. So eine Frau ist zwar nicht sehr gesprächig, aber sie kann gut arbeiten und haushalten. Später folgen schlimmste Hungersnöte. Immer wieder tauchen Gerüchte auf, andere Leute im Dorf äßen ihre Kinder. Das tun Wang Lung und O-Lan zwar nicht, aber nach einer ausgebliebenen Ernte erwürgt O-Lan ihre zweite Tochter nach der Geburt, weil es einfach keine Perspektive für ihr Überleben gibt. Wang Lung macht derweil irgendetwas anderes und stellt keine Fragen. Schließlich sind sie so arm, dass die Familie ihr Land verlassen muss, um in der Stadt nach Arbeit zu suchen. Aber das Geld, dass sie dort erarbeiten und erbetteln können ist zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel. So spielt Wang Lung mit dem Gedanken, seine Tochter als Sklavin zu verkaufen.
Hunger und allgegenwärtige Not konnteich mir in meinem bequemen Leben so gar nicht ausmalen, bis ich Pearl S. Bucks „Die gute Erde“ auf dem Tisch hatte. Im Anschluss habe ich übrigens gleich noch ein Sachbuch von Felix Wemheuer gelesen. In „Der große Hunger“ vergleicht er Hungersnöte unter Stalin und Mao. (Rezension hier).
Pearl S. Buck bekam für „Die gute Erde“ 1938 den Nobelpreis für Literatur. Es hagelte massive Kritik aus dem literarischen Establishment, weil Bucks Werke nur wenig literarischen Wert hätten. Meiner bescheidenen Meinung nach, ist das Werk wirklich nicht unbedingt preisverdächtig, aber als Grund für die Preisvergabe finde ich bei Wikipedia auch nicht besonders hohes Niveau genannt, sondern sie erhielt den Preis für „für ihre reichen und echten epischen Schilderungen aus dem chinesischen Bauernleben und für ihre biographischen Meisterwerke“. „Die gute Erde“ ist unbedingt lesbar, was ich von den Werken vieler anderer nobelpreisprämierten AutorInnen nicht sagen kann: William Faulkner (1949) und Günter Grass (1999) finde ich ganz schwierig zu lesen, Elfriede Jelinek (2004) oder Herta Müller (2009) fast unmöglich.
„Die gute Erde“ ist auf jeden Fall ein echter Lesetipp und ein guter Einstieg in den chinesischen Lesekosmos. Nomadenseele hat das Buch hier rezensiert und gibt auch einen Verweis auf den Roman „Wilde Schwände“ von Jung Chang, den ich hier auch allen empfehlen möchte, die sich für chinesische Geschichte(n) im 20. Jahrhundert interessieren. „Wilde Schwäne“ hat mich noch mehr als „Die gute Erde“ nach China entführt, vielleicht auch, weil es einfach viel dicker ist. Vom Vergnügen, wirklich dicke Bücher zu lesen, schreibe ich hier. Wer auch mal Graphic Novels liest, dem seien auf jeden Fall die drei Bände „Ein Leben in China“ und „Lotosfüße“ von Li Kunwu in der Edition Moderne ans Herz gelegt. Bei Lesen ist Luxus findet ihr eine Blogparade Literarische Weltreise Asien mit noch mehr Lesehinweisen zu China, Laos, Japan und Indien.
1921-1930: Gar nicht so Roaring Twenties (Top 10)
Die Zwanziger haben mich enttäuscht. Ich hatte mir mehr Esprit versprochen. Ein paar Perlen waren aber auch hier dabei.
- Wirklich mitgenommen hat mich Therese von Arthur Schnitzler (1928). Schnitzler find ich insgesamt super.
- Immernoch überzeugt hat mich Babbitt von Sinclair Lewis (1922).
- Ich bin richtig froh, dass ich Im Westen nichts Neues von Erich Maria Remarque (1929) gesehen habe. Es gibt zwei Verfilmungen: von 1930 und von 1979.
- Positiv überrascht war ich von Fiesta von Ernest Hemingway (1926). Es gibt einen Film von 1957.
- Im Rückblick noch blasser erscheint mir Die Brücke von San Luis Rey von Thornton Wilder (1927). Der Film von 2004 reißt das Ruder auch nicht rum.
- Kaum im Gedächtnis geblieben ist mir Eine Gesellschaft auf dem Lande von Aldous Huxley (1921). Das hätte ich nicht erwartet, denn „Schöne neue Welt“ hatte mich jahrelang beschäftigt.
- Enttäuscht war ich von Auf der Suche nach Indien von E.M. Forster (1924). Vielleicht sind Bücher aus Kolonialherrenperspektive aber generell mit Abstand zu betrachten. Es gibt einen Film von 1984, der auch nichts anderes verspricht.
- Bestätigt in meiner früheren Abneigung gegen Joseph Roth hat mich die Lektüre von Hiob (1930).
- Obwohl Theordore Dreiser vielversprechend gestartet ist, habe ich Eine amerikanische Tragödie (1925) nicht bis zum Ende durchgestanden. Ein paar Hundert Seiten weniger würden der Geschichte gut tun.
- Das langweiligste Buch des Jahrzehnts war schließlich Zenos Gewissen (1923) von Italo Svevo.
Auf jeden Fall freue mich mich jetzt auf das nächste Jahrzehnt. Ich reise nach China mit Pearl S. Buck und habe neben Erskine Childers von „Das Rätsel der Sandbank“ (1903) den wahrscheinlich einzig anderen Autoren mit dem Vornamen Erskine auf meiner Liste: Erskine Caldwell. Ich freue mich auf Klaus Manns Tschaikowski-Roman und lasse mich vom Winde verwehen. Ich lese endlich „Der Hobbit und schaue mir dann auch die Filme an. Das werden tolle Jahre!
1930: „Hiob“ von Joseph Roth
 Mit Joseph Roth hatte ich das letzte Mal in der Oberstufe zu tun. Damals nahm die Deutschlehrerin mit uns „Radetzkymarsch“ durch, ein Buch, dass sich für mich in kürzester Zeit als unlesbar herausstellte. Da ich meine, dass sich mein literarischer Horizont in den letzten fünfzehn Jahren etwas erweitert hat, wollte ich auch Joseph Roth eine zweite Chance geben. Durch erneute Annäherung an Schullektüre habe ich in den letzten Jahren immer wieder neue Favoriten für mich entdeckt, so zum Beispiel Gottfried Keller und Fontane. Im Falle von Joseph Roth sollte sich ein solcher Glücksfall für mich jedoch nicht wiederholen.
Mit Joseph Roth hatte ich das letzte Mal in der Oberstufe zu tun. Damals nahm die Deutschlehrerin mit uns „Radetzkymarsch“ durch, ein Buch, dass sich für mich in kürzester Zeit als unlesbar herausstellte. Da ich meine, dass sich mein literarischer Horizont in den letzten fünfzehn Jahren etwas erweitert hat, wollte ich auch Joseph Roth eine zweite Chance geben. Durch erneute Annäherung an Schullektüre habe ich in den letzten Jahren immer wieder neue Favoriten für mich entdeckt, so zum Beispiel Gottfried Keller und Fontane. Im Falle von Joseph Roth sollte sich ein solcher Glücksfall für mich jedoch nicht wiederholen.
Die Geschichte beginnt in einem Kuhdorf in Rußland, wo Mendel Singer, ein armer frommer jüdischer Lehrer mit seiner Familie lebt. Seine Familie, das ist seine Frau Deborah, seine Tochter MirjSam und seine drei Söhne Jonas, Shermajah und der behinderte Menuchim.
Gott hatte seinen Lenden Fruchtbarkeit verliehen, seinem Herzen Gleichmut uns seinen Händen Armut. Sie hatten kein Gold zu wägen und keine Banknoten zu zählen. (Seite 5 der Ausabe aus dem St. Benno-Verlag Leipzig von 1967)
Menuchim ist Epileptiker, was einiges Unglück in die Familie bringt. Doch Menuchim ist so fromm, dass er ihn nicht in ein nichtjüdisches Krankenhaus zur Behandlung bringen will, obwohl ihm das umsonst angeboten wird. Er erfleht lieber Gottes Hilfe. Ein Rabbi hatte Deborah außerdem prophezeit, dass Gott Menuchim eines Tages heilen würde. Die beiden anderen Söhne werden indes zur Armee gerufen, doch Shermajah desertiert und flieht nach Amerika. Dort kommt er zu einigem Wohlstand und möchte die Familie nachholen. Das ist Mendel am Ende auch ganz recht, denn seine Tochter Mirjam trifft sich zu regelmäßigen Schäferstündchen mit einem Kosacken auf dem Feld.
Klar ist aber, wenn die Familie nach Amerika will, muss sie Menuchim zurücklassen. Schweren Herzens beschließen sie, ihn bei Bekannten in Obhut zu geben und machen sich auf nach New York. Mirjam und Deborah leben sich gut ein, aber Medel hadert mit seinem neuen Leben. Als dann der erste Weltkrieg ausbricht, meldet sich Shermajah freiwillig und fällt. Aus Trauer stirbt Deborah gleich hinterher und Mirjam wird wahnsinnig. Das bringt das Fass zum Überlaufen und Mendel wendet sich enttäuscht von Gott ab.
Aus, aus, aus ist es mit Mendel Singer! Er hat keinen Sohn, er hat keine Tochter, er hat kein Weib, er hat kein Geld, er hat kein Haus, er hat keinen Gott! (Seite 133)
Später taucht Menuchim in New York auf. Er ist gesund und wohlhabend. Er nimmt seinen Vater zu sich. Dann macht Mendel seinen Frieden mit der Welt.
So viel zur Geschichte. Für mich war es insgesamt eine eher unbefriedigende Lektüre. Ich fühlte mich vom Schreibstil Roths regelrecht gehemmt. Kurze Sätze hemmen den Erzählfluss und ich hatte das Gefühl, ich müsste der Geschichte jede Wendung energisch abringen. Die Story selbst konnte mich einfach nicht mitnehmen. Das mag unter anderem aber daran liegen, dass Glaubensfragen für mich im Leben insgesamt nicht relevant sind. Außerdem lieferte das Buch mir nicht genügent Informationen über die verschiedenen Personen, sodass sie mir alle oberflächlich und eindimensional blieben. Schade, Joseph Roth gehört nach wie vor nicht zu meinen Lieblingsautoren.
Eine Rezension des des Hörbuchs gibt es bei schiefgelesen.
1929: „Im Westen nichts Neues“ von Erich Maria Remarque
Es gibt Bücher, bei denen habe ich das Gefühl, dass ich sie schonlängst gelesen haben sollte. Entweder weil alle sie gelesen haben wie „Das Lied von Eis und Feuer“ oder weil ich etwas studiert habe, das nahelegt ich hätte das Buch gelesen („Hamlet“!) oder auch, weil ich das Gefühl habe, als gebildete Frau müsse ich wissen, was in dem Buch genau drinsteht. So war es bei „Im Westen nichts Neues“ von Erich Maria Remarque. Und mein Projekt war nun die perfekte Gelegenheit, meine Bildungslücke zu schließen.
 Erich Maria Remarque war 1916 gerade 18 Jahre alt und in der Ausbildung im Lehrerseminar als er eingezogen wurde. 1917 wurde er an die Westfront verlegt. In „Im Westen nichts Neues“ stellt Remarque nun den Schüler Paul Bäumer in den Mittelpunkt, der sich, von seinem Lehrer angestachelt, mit der ganzen Klasse freiwillig zum Krieg meldete und nun seine Erlebnisse an der Westfront schildert.
Erich Maria Remarque war 1916 gerade 18 Jahre alt und in der Ausbildung im Lehrerseminar als er eingezogen wurde. 1917 wurde er an die Westfront verlegt. In „Im Westen nichts Neues“ stellt Remarque nun den Schüler Paul Bäumer in den Mittelpunkt, der sich, von seinem Lehrer angestachelt, mit der ganzen Klasse freiwillig zum Krieg meldete und nun seine Erlebnisse an der Westfront schildert.
Ich bin ja kein Fan von Kriegsberichten. Am wenigsten interessiert mich, wo welche Frontlinie wann lag und wie sich die Gesamtsituation veränderte. Worum es hier geht, hat mich aber berührt. Remarque zeichnet ein genaues Bild der Soldaten, die während des Ersten Weltkrieges in den Gräben hockte und hebt die ganz junge, die „verlorene Generation“ besonders hervor. Der Begriff tauchte ja auch schon im Zusammenhang mit „Fiesta“ von Hemingway auf. Hätte ich den Remarque vorher gelesen, hätte ich vielleicht noch besser verstanden, worum es da eigentlich geht. Paul Bäumers Generation wurde aus den Kinderschuhen direkt an die Front geschickt und so vorschnell zu Erwachsenen gemacht.
Ach Mutter! Für dich bin ich ein Kind, warum kann ich dann nicht den Kopf ein deinen Schoß legen und weinen? Warum muss ich immer der Stärkere und der Gefaßtere sein, ich möchte doch auch einmal weinen und getröstet werden, ich bin doch wirklich nicht viel mehr als ein Kind, im Schrank hängen noch meine kurzen Knabenhosen, – es ist doch erst so wenig Zeit her, warum ist es denn vorbeit? (Seite 173 der wunderbaren Ausgabe aus der Bibliothek des 20. Jahrhunderts)
Die jungen Soldaten haben aber nicht nur ihre Kindheit verloren, sondern auch Ihre Zukunft. Paul sagt auf S. 87 „Der Krieg hat uns für alles verdorben“. Tatsächlich beneidet er die älteren Kameraden, die zu Hause einen Beruf haben und eine Famile zu der sie nach dem Krieg zurückkehren können, während auf die jüngeren Soldaten nach dem Krieg einfach nichts warte. Ein Absturz und Orientierungslosigkeit wären vorprogrammiert. In die Schule zurück und sich dort triezen lassen, ginge nach jahrelangem mannhaftem Soldatsein nicht mehr. Einen Beruf hätten sie aber auch nicht, das Töten sei quasi ihr Beruf. Das der Krieg in den Soldaten ein solches Gefühl von Perspektivlosigkeit ausgelöst haben mochte, war mir gar nicht bewusst.
Beim Lesen des Buches ergab sich für mich nur ein Problem. Meine Hauptlesezeit liegt seit jeher abends in der letzten Stunde vor dem Einschlafen. Aber wenn etwas keine angenehem Gute-Nacht-Lektüre ist, dann sind es Kriegserlebnisse von jungen Schülern. Grundsätzlich bin ich schwer beeindruckt von „Im Westen nichts Neues“ um möchte das Buch jedem empfehlen, der etwas über den Ersten Weltkrieg erfahrem möchte. Zum Schluss halte ich es außerdem mit Tucholsky, der folgendermaßen urteilte: „Das Buch ist kein großes Kunstwerk, aber ein gutes Buch!“
1928: Arthur Schnitzlers „Therese. Chronik eines Frauenlebens“
Während sich die Lesewelt auf der Buchmesse tummelt, bin ich keine 10 Kilometer entfernt mit meinem Infekt in meiner Wohnung gefangen. An Messebesuch ist nicht zu denken. Mein Geist ist nach einem ausführlichen Mittagsschläfchen jetzt aber wieder fit, also mache ich statt Lesefest jetzt meine eigene kleine Blog-Party und schreibe, längst fällig, über „Therese“. Dazu gibt es, ganz österreichisch The Best of Mozart bei youtube.
Eigentlich war Arthur Schnitzler für 1928 nur eine Notlösung. Andre Breton stand ewig auf meiner Liste und ich hatte, obwohl ich 1927 schon ausgelesen hatte, immernoch kein Exemplar von „Nadja“ besorgt. Ich hatte Angst, es könnte wieder kompliziert werden. Mit Schnitzler habe ich vor vielen Jahren aber schon einmal gute Erfahrungen gemacht. „Leutnant Gustl“ hat mich regelrecht vom Hocker gehauen und das Stück „Reigen“ kann ich auch jedem empfehlen, der sich für die Wiener Gesellschaft um die Jahrhundertwende interessiert. „Therese“ ist zwar über 20 Jahre jünger und stammt also von einem wesentlich älteren Schnitzler, ist aber nicht weniger lesenswert.
 Im Mittelpunkt des Romans steht, wie der Titel es erahnen lässt, Therese. Sie wächst als Offizierstochter in Salzburg auf (deswegen auch der Mozart). In ihrer Rolle als brave Tochter langweilt sie sich zu Tode. Es ist von Anfang an klar, dass sie mehr vom Leben will, als einen braven Ehemann. Sie will Herzklopfen, Liebe und Leidenschaft und sie empfindet das gute Kleinbürgertum als heuchlerisch. Erst recht, als Ihre Mutter von Therese verlangt, sich zur Mätresse eines Grafen zu machen, um für das Auskommen der Familie zu sorgen, während der Vater seine Tage in einer Irrenanstalt zubringt. Dazu kann sich Therese aber nicht herablassen. Sie beginnt indes eine Liebschaft mit dem Unteroffizier Max, der sie zwar in Wallungen bringt, ihr aber auch untreu ist. Nachdem es aus ist, schafft Therese den Abschied von der Mutter und geht nach Wien, um sich dort als Kindermädchen zu verdingen. Sie wechselt häufig die Anstellungen. Nie ist sie richtig zufrieden und ohne Zeugnisse kann sie auch keine richtig gute Stellung finden.
Im Mittelpunkt des Romans steht, wie der Titel es erahnen lässt, Therese. Sie wächst als Offizierstochter in Salzburg auf (deswegen auch der Mozart). In ihrer Rolle als brave Tochter langweilt sie sich zu Tode. Es ist von Anfang an klar, dass sie mehr vom Leben will, als einen braven Ehemann. Sie will Herzklopfen, Liebe und Leidenschaft und sie empfindet das gute Kleinbürgertum als heuchlerisch. Erst recht, als Ihre Mutter von Therese verlangt, sich zur Mätresse eines Grafen zu machen, um für das Auskommen der Familie zu sorgen, während der Vater seine Tage in einer Irrenanstalt zubringt. Dazu kann sich Therese aber nicht herablassen. Sie beginnt indes eine Liebschaft mit dem Unteroffizier Max, der sie zwar in Wallungen bringt, ihr aber auch untreu ist. Nachdem es aus ist, schafft Therese den Abschied von der Mutter und geht nach Wien, um sich dort als Kindermädchen zu verdingen. Sie wechselt häufig die Anstellungen. Nie ist sie richtig zufrieden und ohne Zeugnisse kann sie auch keine richtig gute Stellung finden.
Die Stunden des ruhigen, allmählichen Erwachens, wie sie ihr noch vor kurzer Zeit in der Heimat vergönnt gewesen waren, kamen ihr in wehmütiger Erinnerung, zum erstenmal faßte sie mit Schrecken die Tiefe ihres Abstiegs und die Geschwindigkeit mit der er sich vollzog. (Seite 58)
Am Rande des gesellschaftlichen Abgrundes balanciert Therese fortan ihr ganzes Leben. Sie bekommt ein uneheliches Kind, denn auf leidenschaftliche Vergnügungen kann und will sie als Frau nicht verzichten. Aber eine glückliche Ehe einzugehen oder mit ihrem Sohn in Frieden zu leben, dieses Glück bleibt ihr verwehrt. Schließlich ist sie auch neidisch auf ihre Herrschaften, von denen sie abhängig ist.
… immer wieder erbitterte es Therese, daß Frau Direktor sich bei jeder Gelegenheit nach Herzenslust schonen und ins Bett legen konnte, während man auf sie, die am Ende doch auch eine Frau war, nie und nimmer Rücksicht nahm und niemals Rücksicht genommen hatte. (Seite 180)
Die Ungerechtigkeiten, die Therese im Laufe ihres Lebens wiederfahren, schockieren mich enorm. Es ist unglaublich, wie unmöglich es für ein Mädchen aus der Unterschicht war, im Laufe eines Lebens in trockene Tücher zu kommen, geschweige denn auch noch auf persönliche Erfüllung im Leben zu hoffen. Schnitzler zeigt hier eine Situation, die von der bürgerlichen Gesellschaft wahrscheinlich lieber nicht wahrgenommen worden ist. Auch heute denkt man ja oft, dass sich in den 20er Jahren schon einiges an Frauenselbstbestimmung getan hat, aber die Frauenbewegung war wohl lange lange Zeit eine Oberschichtenvergnügung!
1927: Am Ende ist es immer die Liebe – Thornton Wilders „Die Brücke von San Luis Rey“
Vor einigen Jahren habe ich, während ich krank auf dem Sofa lag, einen Trailer vom Film „Die Brücke von San Luis Rey“ gesehen. Ich liebe Historiendramen und die Besetzung vielversprechend: Robert DeNiro, Kathy Bates, Gabriel Byrne und Harvey Keitel. Meine Mutter schwärmte dann von dem Buch von Thornton Wilder, das ich dann natürlich lesen wollte, bevor ich mir den Film anschaue. So kam es, dass ich den Film bis jetzt noch nicht gesehen habe und das Buch auf meiner Leseliste landete.
schwärmte dann von dem Buch von Thornton Wilder, das ich dann natürlich lesen wollte, bevor ich mir den Film anschaue. So kam es, dass ich den Film bis jetzt noch nicht gesehen habe und das Buch auf meiner Leseliste landete.
Der Inhalt ist schnell erzählt: An einem Tag in Peru im 18. Jahrhundert reißt eine Hängebrücke und fünf Menschen stürzen mit ihr in die Tiefe. Halb Peru ist schockiert und bewegt. Der Franziskanermönch Bruder Juniper möchte nun anhand einer genauen Untersuchung des Lebens dieser fünf Personen die Göttliche Vorherbestimmung nachweisen:
Wenn es überhaupt einen Plan im Weltall gab, wenn dem menschlichen Dasein irgendein Sinn innewohnte, mußte er sich, wenn auch noch so geheimnisvoll verborgen, sicherlich in diesen fünf so jäh abgeschnittenen Lebensläufen entdecken lassen. (S. 11 in der Ausgabe von Volk und Welt Berlin 1976, übersetzt von Herberth E. Herlitschka)
Im Schnelldurchlauf (das Buch hat nur 143 Seiten) springen wir durch die Leben der Marquesa de Montemayor, die für ihre Liebe von ihrer Tochter verachtet wird, von ihrer Gesellschafterin Pepita, einem Waisenkind aus dem Kloster, das wegen ihrer Liebe zur Äbtissin im freudlosen Leben mit der Marquesa ausharrt. Wir sehen Emanuel, der nach dem Tod seines Zwillingsbruders Manuel selbst todtraurig ist und schließlich den „bejahrerten Harlekin“ Onkel Pio, der sein Leben hingegeben hat für seine Liebe zur Schauspielerin Perichole, und deren Sohn, der kränklich ist und kein langes Leben zu erwarten hat. Während des Lebens frage ich mich natürlich die ganze Zeit, warum ausgerechnet diese fünf in die Schlucht stürzen müssen: ist es guter Lebenswandel, der belohnt oder bestraft wird? Was haben die Figuren gemeinsam? Natürlich findet sich die ein oder andere Gemeinsamkeit, gemeinsame Bekannte, aber der kleinste gemeinsame Nenner scheint am Ende die Liebe zu bleiben.
Die Lektüre dieses dünnen Büchleins war jedenfalls seine Zeit wert. Es war zwar nicht so umwerfend wie erwartet, aber kurzweilig und bewegend.
Nachdem ich nun drei Amerikaner gelesen habe, nach Dreiser, Hemingway und Wilder geht es als nächstes zurück nach Europa, nach Österreich, zu Arthur Schnitzler und „Therese. Chronik eines Frauenlebens“.
1926: ‚Fiesta‘ in Pamplona mit Hemingway
Fiesta steht schon lange auf meinem Wunschzettel. Ich habe schon vor zehn Jahren einen Versuch gestartet, damals aber mit einem DDR-Taschenbuch, das ich nach 30 Seiten mit dem Fazit „Hemingway geht echt gar nicht!“ in die Ecke pfefferte. Naja, in der Zwischenzeit habe ich dann doch noch mal einen probiert. Der Garten Eden war gar nicht so übel. Also auch noch ein neuer Versuch mit Fiesta.
Fiesta ist 2014 bei rohwohlt in einer vom Deutschen Übersetzerfond geförderten Neuübersetzung erschienen. Die Leseprobe liest sich sehr gut an. Ich habe allerdings eine alte Ausgabe von 1963 aus der Büchergilde Gutenberg gelesen. 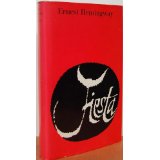 A propos Übersetzung: Ich habe mich immer gefragt, warum das Buch im Original The Sun Also Rises heißt und auf Deutsch Fiesta. Lange war mir erst gar nicht klar, dass es sich um das gleiche Buch handelt. In der Zwischenzeit habe ich herausgefunden, dass Fiesta der Arbeitstitel war. Leuchtet mir auch absolut ein, schließlich erstreckt sich die Handlung des Großteils des Romans Geschehnisse während einer Fiesta in Pamplona. und sich der finale amerikanische Titel auf eines der vorangestellten Zitate bezieht. In meiner Ausgabe steht da:
A propos Übersetzung: Ich habe mich immer gefragt, warum das Buch im Original The Sun Also Rises heißt und auf Deutsch Fiesta. Lange war mir erst gar nicht klar, dass es sich um das gleiche Buch handelt. In der Zwischenzeit habe ich herausgefunden, dass Fiesta der Arbeitstitel war. Leuchtet mir auch absolut ein, schließlich erstreckt sich die Handlung des Großteils des Romans Geschehnisse während einer Fiesta in Pamplona. und sich der finale amerikanische Titel auf eines der vorangestellten Zitate bezieht. In meiner Ausgabe steht da:
Die Erde bleibet aber ewiglich. Die Sonne gehet auf und gehet unter und läuft an ihren Ort, daß sie wieder dasebst aufgehe …
Das klingt für mich etwas nach dem Kreis des ewigen Lebens, was ich irgendwie nicht so richtig mit dem Inhalt des Romans in Verbindung bringen kann. Der setzt nämlich im Paris der 20er Jahre ein: Erzähler Jake und andere Amerikaner und Engländer leben ein Leben voller Partys, Alkohol und Zigaretten, in dem alte Umgangsformen nicht mehr so eine große Rolle spielen. Im Mittelpunkt steht Lady Ashley, genannt Brett, die sich von der traditionellen Frauenrolle emanzipiert. Hemingway beschreibt sie folgendermaßen:
Sie hatte Wölbungen wie eine Rennjacht, und es entging einem nichts unter dem wollenen Jersey. (S. 29)

Natürlich sind alle in sie verliebt, inklusive Jake. Sie folgt ihren Neigungen, mal mit diesem, mal mit jenem Mann. Eine illustre Gesellschaft aus einigen Herren und Brett macht sich auf nach Pamplona zur dortigen Fiesta. Sieben Tage lang sitzen sie in Cafés, trinken massenhaft Wein und Schnaps, besuchen Stierkämpfe. Großes Thema zwischen ihnen bleiben Bretts Amouren. Robert Cohn, mit dem sie sich zuletzt in San Sebastian ein paar nette Tage gemacht hatte, kann nicht mehr von ihr lassen und wird so aufdringlich, dass er für alle Beteiligten zum Spaßverderber wird. Bemerkenswert ist, dass als der Hauptgrund für Cohns Fehlverhalten immer wieder genannt wird, dass er Jude ist!
Abgesehen davon gibt es reichlich Stierkampfszenen. Jake ist ein Stierkampfaficionado, also leidenschaftlich interessiert. Naja, mich hat das nicht so mitgerissen. Für mich fällt Stierkampf in die Kategorie ‚unerklärliches lebensmüdes Verhalten‘, auch noch mit Tierverletzung (ich bin Vegetarierin). Beispielsweise wird, während die Stiere durch die Straßen zur Arena laufen, ein Mann von einem Stier in die Luft geworfen und lebensgefährlich verletzt.
Vor den Stiere liefen so viele Leute her, daß die Masse sich staute und nur langsam durch das Tor in den Toril gelangen konnte, und als die Stiere alle zusammen schwer galoppierend, die Flanken mit Kot bespritzt, mit geschwungenen Hörnern vorbeikamen, schoß einer vor, faßte einen Mann aus der laufenden Menge im Rücken und hob ihn in die Luft. Beide Arme des Mannes hingen seitwärts herunter, sein Kopf fiel nach hinten, als das Horn sich in ihn bohrte und der Stier ihn hochhob und dann fallen ließ. (S. 232f. in der Ausgabe der Büchergilde Gutenberg von 1993, übersetzt von Annemarie Horschitz -Horst)
Auf der Seite der Fiesta San Fermin kann man sich ein Video des Stierlaufs von 2015 anschauen und schnell wird klar: solche Vorfälle waren keine Seltenheit.
Insgesamt ziehe ich ein positives Fazit. Die Lektüre hat sich gelohnt. Die Eindrücke aus Paris sind genau das, was ich mir von ‚Hemingway live aus Paris‘ vorgestellt hatte und die Geschichte in Pamplona hat mich so angesprochen, dass ich am liebsten auch gleich hinfahren möchte (wenn auch nicht zum Stierkampf).
1925: Unter dem Nachttisch
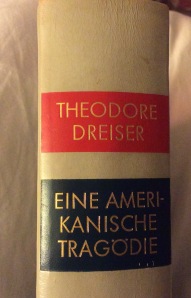 Kennt Ihr das? Ihr lest ein Buch und es ist eigentlich ganz ok, aber nicht so richtig der Brüller. Irgendwann schweifen die Gedanken ab. Da war doch diese nette Liebesgeschichte, von der die Freundin letztens erzählt hat. Oh, und im Paket von Mutti ist doch dieses Buch von dem finnischen Autor – vielversprechend. Ach, und so ein schöner Krimi wär doch auch mal wieder was. Und dann ist plötzlich das Jahr rum und das Buch, das man eigentlich gerade liest, liest man eigentlich gar nicht mehr und ist schon unter den Nachttisch gerutscht.
Kennt Ihr das? Ihr lest ein Buch und es ist eigentlich ganz ok, aber nicht so richtig der Brüller. Irgendwann schweifen die Gedanken ab. Da war doch diese nette Liebesgeschichte, von der die Freundin letztens erzählt hat. Oh, und im Paket von Mutti ist doch dieses Buch von dem finnischen Autor – vielversprechend. Ach, und so ein schöner Krimi wär doch auch mal wieder was. Und dann ist plötzlich das Jahr rum und das Buch, das man eigentlich gerade liest, liest man eigentlich gar nicht mehr und ist schon unter den Nachttisch gerutscht.
Aber seien wir mal ehrlich. Auch dieses Mal ist mir das nicht zufällig passiert. Nach einer langen Zeit des Projektlesens bin ich ‚meinem‘ Jahrhundert etwas überdrüssig geworden. Aber das Buch „Eine amerikanische Tragödie“ von Theodore Dreiser ist auch mitschuld. Darin geht es um Clyde Griffiths, der aus einer sehr religiösen, aber leider sehr runtergekommenen Familie kommt. Durch die Arbeit als Hotelboy versucht er etwas aus sich zu machen, kommt aber vom rechten Wege ab. Er kostet das süße Leben, atmet den Duft der Frauen und ist fortan für das einfache Leben verdorben. Der Titel verspricht mir, dass sich die Geschichte noch zu einer echten Tragödie auswächst. Bis dahin kann ich aber leider nicht folgen. Szenerien und Gedankengänge erzählt Dreiser fleißig und detailliert und ich bekomme genau die Einsichten in das amerikanische Stadtleben im Kansas City der 20er Jahre, auf die ich hier in meinem Projekt eigentlich scharf bin, aber das Buch ist im Großen und Ganzen einfach nicht fetzig genug. Es langweilt mich, weil ich befürchte, dass nach 233 Seiten Aufstiegsfantasien und Gewissensbissen des Protagonisten noch 423 folgen, auf denen nichts anderes passiert.
Ein Jahr habe ich mich mit dem Buch herumgelangweilt, aber in der meisten Zeit hatte ich unendlichen Spaß mit anderen Büchern. Hier die Top 10 meiner Lieblinge aus 2015:
- André Herzberg – Alle Nähe fern
- Peter Richter – 89/90
- Wolfgang Herrndorf – Tschick
- Florian Ilies – 1913
- Astrid Lindgren – Ronja Räubertochter
- Maxim Leo – Haltet euer Herz bereit
- Kristine Bilkau – Die Glücklichen
- Ian Simmons – Terror
- Franz Kafka – Der Verschollene
- Theodor Fontane – Der Stechlin
2016 bleibe ich wieder am Ball. Ladies und Gentlemen, schalten Sie nicht ab. Als nächstes im Programm: Erneste Hemingway und Thornton Wilder. Da kann ich nur hoffen, dass ich nicht noch einmal so eine amerikanische Tragödie erwische!
1924: Interkulturelle Freundschaft – Nicht jetzt und nicht hier
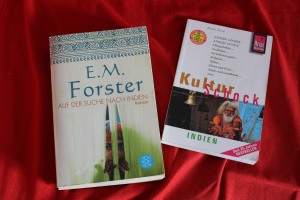 Wenn zwei, die unterschiedliche kulturelle Hintergründe haben, miteinander kommunizieren, kann es manchmal ganz schöne Missverständnisse geben. Mitunter kommen sie auch gar nicht zusammen, aus Angst vor der Fremden oder aus einer Erhabenheitsdenke heraus. Das Thema kommt immer wieder: man denke nur an die Multi-Kulti-Debatte oder an Seminare zu Interkultureller Kommunikation, die an keiner Volkshochschule fehlen. Um zwischenkulturelle Schwierigkeiten ging es aber früher auch schon. Ich denke an die Zeit des Imperialismus. Und genau hier entdecke ich „Auf der Suche nach Indien“ von E.M. Forster. Dass Großbritannien ein großes Kolonialreich hatte, ist bekannt. Indien war das Flagschiff, das Juwel der Britischen Krone. 1876 ließ sich Königin Viktoria zur Kaiserin von Indien krönen. Unzählige Britische Staatsbeamte nahmen die lange Seereise auf sich, um eine europäische Ordnung im Orient zu installieren. Vor Ort hatten sie dann mehr oder weniger intensiven Kontakt zur indischen Bevölkerung.
Wenn zwei, die unterschiedliche kulturelle Hintergründe haben, miteinander kommunizieren, kann es manchmal ganz schöne Missverständnisse geben. Mitunter kommen sie auch gar nicht zusammen, aus Angst vor der Fremden oder aus einer Erhabenheitsdenke heraus. Das Thema kommt immer wieder: man denke nur an die Multi-Kulti-Debatte oder an Seminare zu Interkultureller Kommunikation, die an keiner Volkshochschule fehlen. Um zwischenkulturelle Schwierigkeiten ging es aber früher auch schon. Ich denke an die Zeit des Imperialismus. Und genau hier entdecke ich „Auf der Suche nach Indien“ von E.M. Forster. Dass Großbritannien ein großes Kolonialreich hatte, ist bekannt. Indien war das Flagschiff, das Juwel der Britischen Krone. 1876 ließ sich Königin Viktoria zur Kaiserin von Indien krönen. Unzählige Britische Staatsbeamte nahmen die lange Seereise auf sich, um eine europäische Ordnung im Orient zu installieren. Vor Ort hatten sie dann mehr oder weniger intensiven Kontakt zur indischen Bevölkerung.
Einer der Protagonisten von „Auf der Suche nach Indien“ ist Aziz, ein muslimischer Mediziner. Er diskutiert mit seinen Freunden Hamidullah und Mahmoud Ali, ob es überhaupt möglich ist, mit einem Engländer befreundet zu sein. Sie sind sich schnell einig, dass das unmöglich ist. Selbst die Engländerinnen seien hochnäsig und bestechlich. Die Freunde empören sich über die herablassende Art der Briten, die die Inder im Klub von Tschandrapur noch nicht mal als Gäste zulassen wollen. Forster baut einen starken Gegensatz auf. Bei der Beschreibung Indiens bedient er sich einer fast märchenhaften Sprache:
Das weite Indien – Hunderte von Ländern, die Indien hießen – flüsterte draußen unter der Nacht unter einem gleichmütigen Mond vor sich hin.“ (Seite 18 in meinem Fischer-Taschenbuch)
Auf der anderen Seite steht die Heimat des anglo-indischen Beamtentums:
Die Straßen, auf die Namen siegreicher Generäle getauft und im rechten Winkel sich kreuzend, waren symbolisch für das Netz, das Großbritannien über Indien geworfen hatte und in dessen Machen er (Aziz) sich jetzt verfing.“ (Seite 20)
Es kommt aber doch so, dass Aziz sich mit einem Briten anfreundet. Fielding ist Leiter des Beamtenseminars und ein unkonventioneller Mensch. Er fungiert als Schnittstelle für Bekanntschaften mit weiteren Briten, unter anderem auch für die mit Adela Quested, die nach Indien gekommen ist, um einen Regierungsbeamten zu heiraten. Als die junge Frau auf einem gemeinsamen Ausflug in den stockdusteren Marabar-Grotten angegriffen wird und daraufhin Aziz anzeigt, wird offenbar, dass die Verbindung zwischen Europäern und Indern doch nicht so fest war, wie gehofft. Adela Quested bezichtigt Aziz eines Angriffs und sie muss gar nichts weiter erklären. Letztenendes kommt er ins Gefängnis, weil er ein Inder ist und die Justiz eine englische. Das ist natürlich furchtbar ungerecht, das ist offensichtlich. Und als sie ihren Fehler einsieht, ist Aziz so eingeschnappt, dass er sich von den Briten insgesamt abwendet und der ganze interkulturelle Kontakt ist im Dutt.
Am Ende des Romans beantwortet Forster, die Frage nach einer möglichen Freundschaft zwischen Fielding und Aziz:
Das alles rief mit hundertfach verschiedener Stimme: „Nein, noch nicht“, und der Himmel bestätigte: „Nein, nicht jetzt und nicht hier.“ (Seite 389)
Mein erster Impuls ist, mir einzureden, dass das eben damals so war. Aber mal ehrlich: wie viel weiter sind wir heute gekommen? Könnten heute Unterdrücker und unterdrückte Kultur echte Freunde werden? Diskriminierung ist auch heute ein allgegenwärtiges Problem, in Indien und auch in Europa. Natürlich hat sich viel getan. Kolonien sind unabhängig geworden, es gibt Antidiskriminierungspolitik, der moderne Europäer hält sich für interessiert an der Fremde. Aber weit trägt das noch nicht. Ich schließe mich nun gute 90 Jahre später E. M. Forster an: Fielding und Aziz wären auch heute noch keine Freunde, nicht jetzt und nicht hier.
Fremdgelesen: das 20. Jahrhundert ist nicht genug
Nachdem ich nun 23 Bücher von 1901 bis 1923 gelesen habe, muss ich eine gewisse Ermüdung feststellen. Immer öfter möchte ich Impulsen, einfach das nächstbeste aktuelle Buch zu verschlingen nachgeben. Und immer öfter möchte ich dann auch darüber schreiben. Oder auch mal über eine Reise oder einen Film, eine Platte. Und genau das mache ich jetzt auch auf meinem kultur.blog. 
Akutell blogge ich über ein Fahrradwochenende am Elberadweg und über „Besserland“ von Alexandra Friedmann, die am Donnerstag auch in Leipzig liest. Als nächstes freue ich mich schon auf die Leipziger Buchmesse und auf „Alle Nähe fern“ von André Herzberg. Ach ja, „Auf der Suche nach Indien“ von E. M. Forster (1924) habe ich natürlich nicht vergessen.